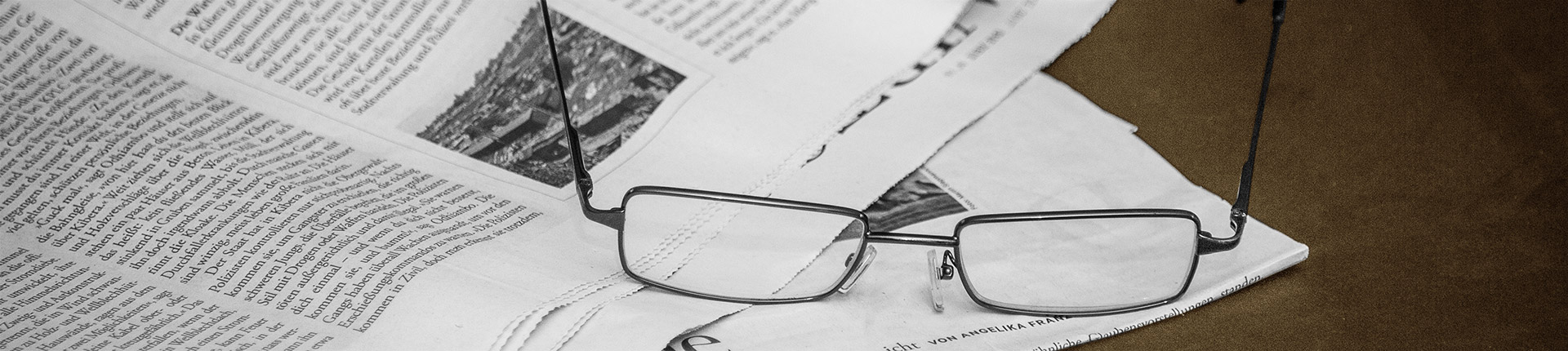Kloster als Zielscheibe
Mitteldeutsche Zeitung, Samstag, 5. April 2025
Tatzeit Ostern 1525: Eine Beitragsserie begibt sich auf Spurensuche, was mit den Zisterzienserinnen in der Region vor 500 Jahren geschah. (Teil 3)


Von Kurt Großkreutz
Mehringen/MZ. Es geschah vor 500 Jahren in der Woche nach Ostern. Aber zum Feiertag „Auferstehung Jesu Christi“ am 16. April 1525, also am Ostersonntag, sollte keine festliche Stimmung unter den Nonnen aufkommen. Vielmehr kündigte sich der jähe Untergang der Mehringer Klostergemeinschaft an.
Ein wütender Angriff aufgebrachter Aufständischer auf das Kloster „Peterstal“ endete mit Zerstörungen und Brandschatzungen des damals etwa 300 Jahre alten Gebäudekomplexes der Zisterzienser-Nonnen. Dennoch sind reichhaltige Spuren einer Periode erfolgreichen Klosterlebens auch 500 Jahre später in Erinnerung und sogar erhalten geblieben.
1 Die Nonnen im Dienst der Allgemeinheit
Der Tagesablauf der Zisterzienserinnen war streng geregelt. Um 5 Uhr begann der Tag im Morgengrauen mit einer Lobpreisung des Herrn. Über den Tag verteilt bestimmten weitere Gebete in der Klosterkirche und Lesungen im Kapitelsaal das Leben. Vormittags und nachmittags waren mehrere Arbeitsstunden u. a. auf den Feldern, in den Gärten oder bei der Handarbeit vorgesehen.
Durch die weit verzweigten Verbindungen der Ordensfrauen zu anderen Klöstern erwarben sie sich immer wieder neue handwerkliche Fähigkeiten und landwirtschaftliche Kenntnisse, die sie auch an die Dorfbevölkerung weitergaben. Sie befassten sich ebenso mit der Regulierung der Wipper, dem Mühlenwesen und Anbau neuer wohlschmeckender Obstsorten. Die Nonnen des Mehringer Konvents sollen besonders für ihre kunstvollen Stickereien von Wandteppichen, Bildern und geistlichen Gewändern berühmt gewesen sein.
Durch die ständige Vergrößerung des Besitzes (u. a. in Eisleben, Bründel und Platendorf) konnten die Nonnen ihr Land bald nicht mehr selbst bewirtschaften. Daher übernahmen Laienschwestern oder -brüder z. B. die Versorgung der Haustiere oder Bestellung der Felder. Außerdem verpachtete das Kloster immer mehr Land, wodurch sich das Vermögen des Klosters weiter mehrte und zu den wohlhabendsten in der Region gehörte.
Im Gegensatz zu den Chorschwestern, die in manchen Orden auch als Lehrerinnen oder im Studium fungierten, waren die Laienschwestern für einfache, meist körperlich anstrengende Arbeiten in Haus und Garten zuständig, versahen Dienst an der Pforte oder führten Besorgungen aus. Durch die Zweiklassengesellschaft innerhalb des Klosters kam es immer wieder zu Spannungen zwischen Mönchen bzw. Nonnen und den Laien.
2 Der Reichtum der Zisterzienser und der Untergang des Ordens
Nach der Blütezeit des Klosterwesens, wo der Fleiß und die moralische Aufrichtigkeit der Mönche und Nonnen höchste Anerkennung und Achtung fanden, setzte im 15. Jahrhundert ein Verfall in allen Bereichen ein. Sitten, Fleiß und Respekt derer, die für das Kloster arbeiteten, verfielen nicht nur in Mehringen.
Mit dem wachsenden Einfluss der Städte sank die Bedeutung der klassischen, monastischen Klöster. Deren Rolle als Zentren der Kultur und Entwicklung übernahmen immer mehr die Städte mit ihren Handwerkern, Schulen und Universitäten. Es war ein Phänomen von europäischem Ausmaß.
Die Ausbeutung der Bauern oder der Ablasshandel der Kirche riefen Reformer wie Martin Luther oder Melanchthon auf den Plan. Aber es gab auch Vertreter in der Kirche, die weiter gingen und für „Freiheyt“ und „Gerechtigkeyt“ zu den Waffen riefen. Thomas Münzer, der in unserer Region, insbesondere 1515 bis 1517 als Probst im Kanonissenstift Frose wirkte, schwang sich zum radikalen Anführer der Bauern auf. Als Schlösser, Burgen und Klöster im Unstruttal von Thomas Münzer und seinen „Schwarzen Haufen“ gestürmt waren, weitete sich der Aufstand weiter aus. Die Walze der Kriegsscharen rollten über Orte und Klöster wie Eisleben, Sittichenbach, Hettstedt, Mansfeld, Wiederstedt, Walbeck, Arnstein oder Konradsburg.
Die Nonnen in Mehringen unter ihrer Äbtissin Margarita Heydyken befürchteten, dass die aufgebrachten Bauern und ihre Verbündeten bald auch ihr Kloster bedrohen könnten. In den Nächten konnte man am Horizont die Feuer ausmachen, die von den in Flammen aufgegangenen Gebäuden stammten.
Das Kloster Mehringen war ebenfalls Zielscheibe der unterdrückten und ausgebeuteten Bauern geworden. Das Kloster an der Wipper war zu Reichtum gekommen, ließ mehr und mehr Menschen für sich arbeiten und verwaltete den Reichtum. Die Werte der Zisterzienser seit der Gründung des Ordens gerieten immer mehr in Vergessenheit und die Missgunst bei der Bevölkerung nahm zu.
Die Nonnen verließen in der Osterzeit 1525 angsterfüllt ihr Kloster, um Schutz in Bernburg bei Fürst Wolfgang von Anhalt-Köthen (1492 – 1566) zu suchen.
3 Die Erstürmung des Klosters in Mehringen
Im Jahr 1525 fiel der Ostersonntag auf den 16. April. In der Woche nach Ostern versammelten sich Aufständische vor den Mauern des verlassenen Klosters Mehringen. Ein Widerstand war also nicht zu erwarten. Der Mehringer Pfarrer Ewald Kühne schilderte 1899 in der „Geschichte von Mehringen“ den Überfall auf das Kloster wie folgt:
„Da brach in der Osterwoche des Jahres 1525 eine wilde Horde, mehreres Gesindel, beiderlei Geschlechts des Nachts in das leerstehende Kloster, stürzten mit Feuerbränden in die Kirche, warfen die Glocken herab, zertrümmerten Orgel und die Bilder und Altäre und überließen sich allen Greueln der Zügellosigkeit. Fenster und Thüren wurden zerschlagen, Bücher und Schriften vernichtet. Mit der Zerstörung wurde am folgenden Tage fortgefahren, bis zuletzt nur die massiven vom Brande geschwärzten Steinwände übrig blieben.“
Am gleichen Tag wurde auch das Zisterzienser-Nonnenkloster in der Ascherslebener Vorstadt „Auf dem Lieben Wahn“ angegriffen und bis in die Nacht hinein verwüstet. Auch hier verließen die Nonnen das Kloster in weiser Voraussicht. Sie fanden Schutz in den Mauern der Stadt Aschersleben.
Der Westdorfer evangelische Pfarrer, Historiker und Dichter Caspar Abel berichtete 1754 in seiner Schrift „Stiffts-, Stadt- und Land-Chronick Des jetzigen Fürstenthums Halberstadt“ von einer ähnlichen Vorgehensweise in Aschersleben wie in Mehringen.
„Die Nacht aber, da ein Geschrey kam daß auch Märing (Mehringen d. V.) und Walbeck geplündert, geschah von der Vor-Städtern ebenfalls ein Einfall ins Kloster von Männern und Frauen, und trugen hinweg, was man regen konnte, ungeachtet des Raths gedroheter Straffe, ruhet auch nicht des Nachts, und obgleich die Bürger in der Stadt auf die Mauer gegen das Kloster verordnet, die über 100 Schüsse ins Kloster thaten, scheueten sie sich doch nicht, sondern stiegen mit Leuchten auf die Kirche, worffen die Glocken hernieder, zerrissen die Orgel und nahm ein jeder eine Pfeife, pfiffen, klungen, sungen und juchzten die gantze Nacht, was sie von Bier nicht austrinken konnten, liessen sie in den Dreck laufen, die Bücher worden in den Brunn geworfen, Fenster, Thüren, alles zerschlagen, die Kirche gantz aufgebrochen und in einen Hauffen gerissen, in summa es ging wüst zu. Damit aber nicht alles in die Rappuse (Plünderung d. V.) gieng, nahm der Rath, was noch an Vieh und Pferden vorhanden, sub inventario zu sich und theilte es unter die Bürger, das ein jeder folgends theuer genug bezahlen muste.“