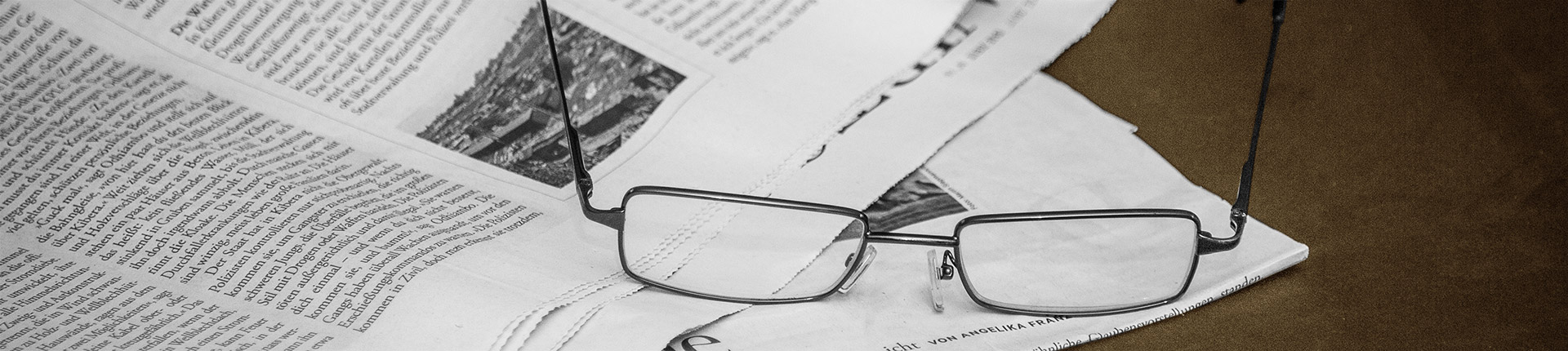Tatort Kloster Mehringen
Tatzeit Ostern 1525: Eine Beitragsserie begibt sich auf Spurensuche, was mit den Zisterzienserinnen in der Region vor 500 Jahren geschah. (Teil 1)
 Der Auszug aus der geschichtlichen Karte des Kreises Quedlinburg und des Stadtkreises Aschersleben zeigt, wo das Kloster Peterstal einst lag. Repro: Kurt Großkreutz
Der Auszug aus der geschichtlichen Karte des Kreises Quedlinburg und des Stadtkreises Aschersleben zeigt, wo das Kloster Peterstal einst lag. Repro: Kurt Großkreutz
 So sieht das Innere der alten Klosterkirche heute aus. Foto: Kurt Großkreutz
So sieht das Innere der alten Klosterkirche heute aus. Foto: Kurt Großkreutz
Mitteldeutsche Zeitung von Kurt Großkreutz
Mehringen/MZ. Es geschah vor 500 Jahren in der Woche nach Ostern. Aber zum Feiertag „Auferstehung Jesu Christi“ am 16. April 1525, also am Ostersonntag, sollte keine festliche Stimmung unter den Nonnen aufkommen. Vielmehr kündigte sich der jähe Untergang der Mehringer Klostergemeinschaft an.
Ein wütender Angriff aufgebrachter Aufständischer auf das Kloster „Peterstal“ endete mit Zerstörungen und Brandschatzungen des damals etwa 300 Jahre alten Gebäudekomplexes der Zisterzienser-Nonnen. Dennoch sind reichhaltige Spuren einer Periode erfolgreichen Klosterlebens auch 500 Jahre später in Erinnerung und sogar erhalten geblieben.
1 Die Entstehung des Zisterzienser-Ordens 1098:
Der siebzigjährige Robert von Molesme (um 1028 bis 1111) gründete 1098 mit 21 weiteren ehemaligen Benediktiner-Mönchen mitten in einer französischen Einöde bei Cîteaux eine asketisch lebende Klostergemeinschaft. Der latinisierte Ortsname lautet: „cistercium“, daher die deutsche Bezeichnung Zisterzienser für diesen Orden. Der Ortsname „Cîteaux“ stammt aus der Zeit vor der Klostergründung, seine Herkunft und Deutung sind ungewiss.
Robert von Molesme und seine Mitstreiter wandten sich wegen der nachlässig gewordenen Lebensweise von den Benediktinern ab. Stattdessen setzten sie sich das Ziel, zu den strengen Regeln „ora et labora“ (bete und arbeite) in Weltabgeschiedenheit und einfacher Lebensweise zurückzufinden.
In Frankreich werden die Zisterzienser als „Bernhardiner“ bezeichnet, denn ein Bernhard von Clairvaux (um 1090 bis 1153) gilt als einer der bedeutendsten frühen Mönche des Ordens. Ihm wird zugeschrieben, sich für die Ausbreitung der Zisterzienser über ganz Europa eingesetzt zu haben.
Er war es aber auch, der mit zu den Förderern des militanten Templerordens (geistlicher Ritterorden 1118-1312) gehörte und sich fanatisch für den zweiten Kreuzzug (1147/49) einsetzte.
2 Die strengen Regularien der Zisterzienser:
Neue „Zisterzen“ (Zisterzienserklöster) für Mönche sollten fortan nur in unbewohnten und wasserreichen Gegenden erbaut werden und die Möglichkeit für eine ausgedehnte Landwirtschaft im Eigenanbau bieten.
Im Umfeld einer „Zisterze“ lagen deshalb zusätzliche Wirtschaftshöfe. Die eigentliche Klosteranlage, auch die Kirche, sollten einfach und schmucklos sein. Der Verzicht auf Türme auf den Klostergebäuden war ursprünglich ein Kennzeichen der Zisterzienser. Die Kirche sollte nur einen Dachreiter für die Glocke besitzen.
Bernhard von Clairvaux reformierte auch die Architektur der Klöster nach dem sogenannten „Bernhardinischen Plan“. Als besonders wichtig galt der völlige Verzicht auf bauplastischen Schmuck und Malereien. Die Reduzierung der Ausstattung, in Kombination mit der monumentalen Größe der Kirchen, übt auch heute noch eine starke Raumwirkung aus. Mit den Zisterziensern verbreitete sich die gotische Architektur in ganz Europa.
Insgesamt entstanden 91 Männerklöster auf dem Gebiet des späteren Deutschlands. Das erste war das 1123 gegründete Kloster Kamp im heutigen Regierungsbezirk Düsseldorf. Zwar war der Orden erst ab 1190 dazu bereit, auch Frauenklöster in den Orden zu inkorporieren, trotzdem entstanden schon im 12. Jahrhundert in Deutschland 15 Konvente für das weibliche Geschlecht.
Insgesamt gab es etwa 160 Zisterzienserinnenklöster im deutschen Sprachraum, zwei davon im heutigen Stadtgebiet von Aschersleben. Allerdings war es nach 1228 nicht mehr möglich, weitere Frauenklöster in den Orden aufzunehmen. Um 1300, waren die Zisterzienser in den meisten Ländern Europas vertreten und zählten 742 Niederlassungen, davon etwa 300 im deutschsprachigen Raum.
Einst als Gegenmodell zum verweltlichten Benediktinerorden entstanden, entwickelten sich die Zisterzienser zum mittelalterlichen Reformorden schlechthin und damit innerhalb weniger Jahrzehnte zum führenden Orden der katholischen Kirche in Europa.
3 Oda, die Edelfrau aus Mehringen, stiftet ein Kloster:
Eine Edelfrau, namens Oda von Mehringen, brachte ihre Familie durch die Stiftung des Klosters Mehringen im Jahre 1222 in ewige Erinnerung. Sie gehörte dem angesehenen und reichbegüterten Geschlecht im Wippertal an. Nachdem sie an Hoyer von Friedeburg verheiratet wurde, zog Oda zu ihrem Ehemann auf dessen gleichnamiges Schloss an der Saale. Sie war aber bis zu ihrem Ableben (1255 oder 1256) um das Wohl ihres Heimatortes und des Klosters bedacht.
Papst Gregor IX. unterstellte 1232 das Mehringer Stift dem Kloster Sittichenbach, welches bereits 1141 gegründet wurde. Gegenwärtig ist Sittichenbach ein Ortsteil von Lutherstadt Eisleben.
Die Klöster fungierten als regionale Entwicklungszentren und wurden zu Stützpunkten der Missionierung sowie Kultivierung. Umsichtige wohlhabende Personen erkannten dieses Potential der Mönche und Nonnen für ihren Wirkungskreis und gründeten Klöster oft in unterentwickelten Gegenden. Voraussetzung war die Möglichkeit, die Klöster mit entsprechenden Ländereien auszustatten. Die Bezeichnung „Stift“, die an eine Stiftung durch einen weltlichen Herrn erinnert, ist daraus entstanden.
Auch vor den Toren Ascherslebens fielen die Ideale der Zisterzienser auf fruchtbaren Boden. An der Eine gründeten Nonnen im 13. Jahrhundert das Zisterzienserinnenkloster „St. Marien“. Das genaue Entstehungsjahr ist strittig.
Odas Motive für die Mehringer Stiftung sollen darauf zurückgehen, das Ansehen und den Ruhm ihrer Familie für die Nachwelt zu erhalten. Sie muss sich mit den Zielen des Ordens identifiziert haben. Die ursprüngliche Einfachheit der monastischen Lebensweise und das Ideal, von der eigenen Hände Arbeit zu leben, sollten wieder gepflegt und die erstarrten Verhaltensweisen des Mönchtums durchbrochen werden. Außerdem strebte man ein Loslösen von unverdientem Eigentum an. Die Oberaufsicht des Abts vom Mutterkloster Cîteaux sorgte dafür, die Leitlinien des Ordens durch regelmäßige Visitationen zu wahren.
Mönche und Nonnen folgten den gleichen Regeln mit geringen geschlechtsspezifischen Abweichungen. Das galt sogar für die Bekleidung, die auch nachts nicht abgelegt wurde. Aber im Gegensatz zu den Männerklöstern wurden die der Zisterzienserinnen von Anfang an in der Nähe von oder in Städten erbaut. Die Forderung nach Einsamkeit wurde durch hohe Umfassungsmauern erfüllt.